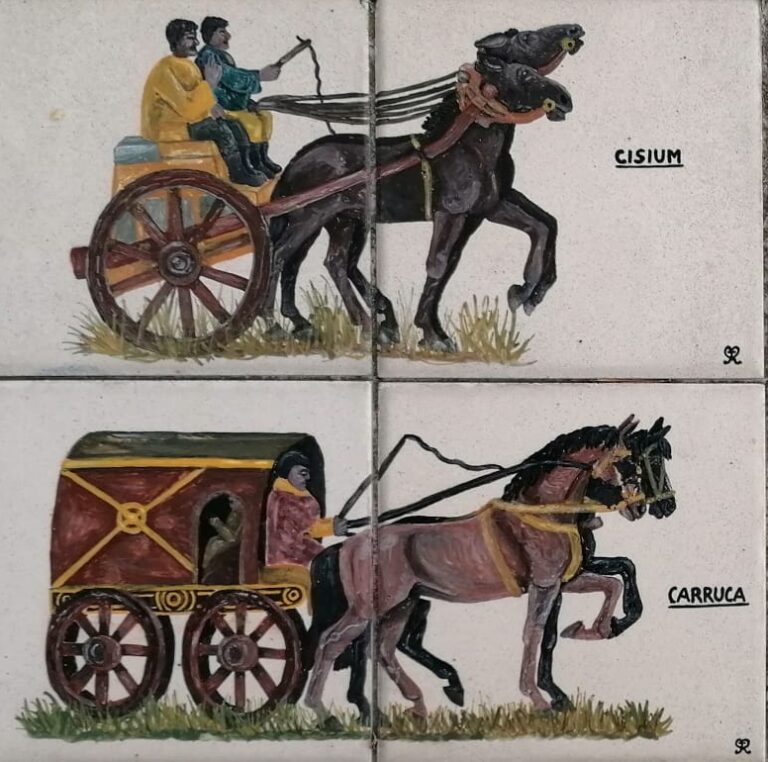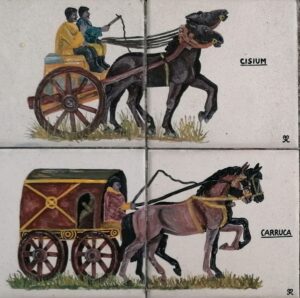Bernsteinstraße als Militär-, Handels- und Poststraße
Ein gut ausgebautes Straßennetz war eine wesentliche Voraussetzung für die Expansion bzw. Sicherung des römischen Weltreiches, das sich in seiner Blütezeit auf drei Kontinente erstreckte. Die Straßen bildeten eine ständige Verbindung der Provinzen mit Rom und sicherten eine schnelle Präsenz der römischen Truppen in Krisengebieten und Kriegsschauplätzen. Neben ihrer Funktion als Militärstraße war das Straßennetz auch die Voraussetzung für Handel und Wirtschaft, für die Postbeförderung, aber auch für die Ausbreitung der römischen Kultur.
Das römische Straßennetz hatte zur Zeit der größten Reichsausdehnung eine Gesamtlänge von ca. 80.000 bis 100.000 km an Staatsstraßen und ca. 200.000 km an Nebenstraßen. Die Bernsteinstraße als wichtige Militär-, Handels- und Poststraße von der Adria in die römischen Provinzen Noricum bzw. Pannonien bis Carnuntum an der Nordgrenze des Reiches war eine Staatsstraße, eine „via publica“. Von dieser zweigten zahlreiche Nebenstraßen und Wege ab. Zwischen den Städten, die aus Militärlagern entstanden, entwickelten sich im Abstand von 15 km bis 20 km Straßenstationen („mansiones“, „mutationes“) mit Herbergen, Stallungen, Scheunen, Wagenreparaturwerkstätten und Pferdewechselstationen für die kaiserliche Post („cursus publicus“).
Die Stationen, die Städte, wichtige Flussübergänge und Gebirge entlang des römischen Straßennetzes waren auf Karten verzeichnet. Zusätzlich zu den Karten gab es Reiseroutenbeschreibungen („Itinerarien“). Die bekannteste antike Straßenkarte ist die Tabula Peutingeriana, eine aus 11 Pergamentblättern bestehende Kartenrolle in der Wiener Nationalbibliothek. Sie zeigt auf 6,75 m Länge, aber nur 34 cm Höhe – daher stark verzerrt – das gesamte römische Weltreich von Spanien bis Mesopotamien, also Europa westlich des Rheins und südlich der Donau, aber mit Britannien, Nordafrika und Arabien sowie die bis Indien reichenden Eroberungen Alexander des Großen. Eingezeichnet sind mehr als 500 Städte und 141 Hauptstraßen. Meere, Gebirgszüge und Flüsse sind stilisiert gezeichnet, genau angegeben sind aber alle Straßenstationen und die Entfernungen in Meilen (1 römische Meile = 1,481 km).
Die Straßen des Römischen Reiches wurden hauptsächlich von technischen Militärexperten konzipiert und trassiert. Sie wurden meist schnurgerade und unter bestmöglicher Vermeidung von größeren Steigungen und teuren Bauwerken angelegt. Im Idealfall war eine römische Straße aus vier verschiedenen Schichten aufgebaut: die Grobschichtung („statumen“) aus größeren, mindestens 30 cm großen Steinen; die ca. 25 cm starke Grobschüttung („ruderatio“) aus faustgroßen, teilweise mit Kalk und Mörtel verbundenen Kieseln; darüber die ca. 30 cm dicke Feinschüttung („nucleus“) aus nussgroßem Schotter und schließlich die Fahrbahndecke („summa crusta“) aus Sand und Kies bzw. in den Städten aus Pflastersteinen. Der gesamte Straßenaufbau erreichte damit eine Höhe bis zu einem Meter.
Im Sommer 1988 wurde von Archäologen im gut erhaltenen Streckenabschnitt der Bernsteinstraße im Urbarialwald von Großmutschen im Mittelburgenland eine Schnittgrabung durchgeführt. Dieses Teilstück ist als Dammstraße noch heute gut erkennbar und steht seit 1931 unter Denkmalschutz. Die Unterkante des Dammes hat eine Breite von ca. 7 Metern, die Fahrbahnbreite beträgt ca. 4 Meter.

Abb.: Originaltrasse der Römischen Bernsteinstraße als Dammstraße im Großmutschner Urbarialwald – seit 1931 unter Denkmalschutz (Foto von Elisabeth Gruber)
Heiling Irene: Die römische Bernsteinstraße im Mittelburgenland. Burgenländische Heimatblätter, 51. Jhg., Heft 3. Eisenstadt, 1989, S. 97 ff.
Stern, Josef: Wege um die Bernsteinstraße. Burgenländische Heimatblätter, 70. Jahrgang, Heft 4. Eisenstadt, 2008, S. 197 ff.
Kaus, Karl: Eine Wanderung über die Römische Bernsteinstraße von Carnuntum nach Savaria. Vorschläge für Lehrausgänge, Radwanderungen und Exkursionen. Schriftenreihe des Pädagogischen Institutes des Bundes für Burgenland. Eisenstadt, 2004.